Die JEWISH ALLSTARS laufen auf. Siebzehn prägnant verfasste Lebensläufe, als Portraits kunstvoll in Szene gesetzt und im Sammelkartenformat aufgelegt. Diese Auswahl deutscher Sportidole, von denen heute viele vergessen sind, verbindet allein ihre jüdische Herkunft. Dabei werden auch Sportlerinnen und Sportler portraitiert, die sich selbst nicht als Juden sahen, aber von der NS-Gesetzgebung als solche definiert, entrechtet und verfolgt wurden. Die JEWISH ALLSTARS erschienen anlässlich der European Maccabi Games 2015.
Herausgeber: Stephan Felsberg & Tim Köhler | Autoren: Martin Brand & Robert Kalimullin | Illustrationen: Thomas Gronle
 Emanuel Lasker (1868-1941)
Emanuel Lasker (1868-1941)
Eine Zigarre im Mund, das linke Knie mit der Hand umfasst, der Gesichtsausdruck stoisch: Emanuel Lasker konnte seine Gegner am Brett zur Verzweiflung bringen. An seiner Mimik jedenfalls lässt sich nicht ablesen, ob die Stellung vorteilhaft für den Mann ist, der sich von 1894 bis 1921 Schachweltmeister nennen durfte. Ganze 27 Jahre – und damit länger als irgendjemand vor oder nach ihm – trug er den Titel. Wahrscheinlich analysiert das Genie gerade die Feinheiten der Partie, plant eine taktische Finesse. Möglicherweise erinnert er sich an einen sonnigen Tag am See in der Nähe seiner Heimatstadt Berlinchen (Neumark), wo sein großer Bruder mit den Füßen ein Schachspiel in den Sand malte. Vielleicht denkt er auch über ein anregendes Gespräch mit seinem Berliner Nachbarn Albert Einstein nach. Oder er grübelt über einen Gedanken für eine weitere philosophische Abhandlung – denn der Intellektuelle und Weltbürger Lasker ist in vielen Disziplinen zu Hause. 1933 flieht er aus dem nationalsozialistischen Deutschland zunächst nach Moskau und von dort vor dem Stalinismus weiter nach New York, wo er seine letzten, entbehrungsreichen Lebensjahre verbringt. Der See bei Berlinchen, das Wasser seiner Kindheit, sei doch irgendwie schöner gewesen, erklärt er seiner Frau an den Niagarafällen. „Im Leben werden die Partien nie so unstrittig gewonnen wie im Spiel“. Dies hatte der große Denker bereits 1925 in seinem Schachlehrbuch geschrieben. „Das Spiel gibt uns Genugtuungen, die uns das Leben versagt.“
 Alfred & Gustav Felix Flatow (1869-1942, 1875-1945)
Alfred & Gustav Felix Flatow (1869-1942, 1875-1945)
Fast hätten Alfred und sein Cousin Gustav Felix Flatow die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit verpasst. Beide zählen zu den erfolgreichsten Turnern ihrer Zeit. Doch in der Deutschen Turnerschaft gibt es damals erheblichen Widerstand gegen die Idee, Leibesübungen in einem sportlichen Wettkampf zu bewerten und einen Sieger zu küren. Und weil die nationalistisch gesinnte Deutsche Turnerschaft darüber hinaus ein internationales Sportfest der Völker ablehnt, boykottiert sie die Olympischen Spiele 1896 in Athen. Alfred und Gustav Felix Flatow fahren trotzdem nach Griechenland – und erringen mit einigen gleichgesinnten Berliner Turnern die Mannschafts-Olympiasiege am Barren und Reck. Alfred holt zudem den Einzeltitel am Reck. Auch nach seiner aktiven Zeit engagiert sich Alfred Flatow für das Turnen, sein Cousin hingegen schließt mit dem Sport ab und widmet sich seiner Textilfirma. Doch als im Frühjahr 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen, beginnt für die beiden jüdischen Sportler die Zeit des Leidens. Alfred Flatow wird zum Austritt aus der Deutschen Turnerschaft gezwungen, Gustav Felix Flatow flieht vor der antisemitischen Hetze in die Niederlande. Der Deportation und Vernichtung entkommen beide nicht. Alfred Flatow stirbt 1942 im Lager Theresienstadt, Gustav Felix Flatow verhungert drei Jahre später am selben Ort. Seit 1997 trägt eine Allee am Berliner Olympiastadion den Namen der beiden Turner.
 Walther Bensemannn (1873-1934)
Walther Bensemannn (1873-1934)
Der Ball muss eigens aus der Schweiz importiert werden. Denn 1889 gilt Fußball in Deutschland noch als „englische Modetorheit“. Und als auch noch eine Fensterscheibe zu Bruch geht, droht Walther Bensemann als Initiator eines Pausenkicks vor der Schule gar Ärger mit dem Gesetz. Doch der Siegeszug des Sports von der Insel ist nicht aufzuhalten, und Bensemann, der auf einer englischen Schule in der Schweiz seinen Faible für alles Englische entdeckt hatte, ist einer seiner Pioniere in Deutschland. An der Gründung mehrerer Vereine, darunter den Vorläufern von Eintracht Frankfurt und Bayern München, ist er ebenso beteiligt wie an der Geburtsstunde des Deutschen Fußballbunds. Im Jahr 1920 gründet Bensemann die Fußball-Zeitschrift „Kicker“. Dabei ist Fußball für Bensemann weit mehr als nur ein Spiel: Der Sport soll nach Ansicht des gebürtigen Berliners Klassen und Völker verbinden und nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs Frieden stiften. Aus diesem Geist heraus steht Bensemann auch rein jüdischen Clubs kritisch gegenüber – er befürwortete eine Integration in die Gesellschaft. Doch letztlich kann sich der rastlose Reisende und Organisator, der zeitweise in Hotels und Eisenbahnabteilen lebt, in Verbandskreisen nicht gegen eine engstirnig-nationale Vision vom Sport durchsetzen. Bereits ein Jahr nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler stirbt Bensemann im Schweizer Exil. Nur wenige Nachrufe gedenken in seiner Heimat einem der Gründerväter des deutschen Fußballs.
 Gottfried Fuchs (1889-1972)
Gottfried Fuchs (1889-1972)
Am 1. Juli 1912 kurz nach 17 Uhr erlebt Gottfried Fuchs die Sternstunde seiner Fußballlaufbahn. Mit 16:0 fegt die deutsche Mannschaft das russische Team bei den Olympischen Spielen in Stockholm vom Platz. Fuchs erzielt in dieser Begegnung zehn Tore – bis heute ein einsamer Rekord. Keinem deutschen Nationalspieler nach ihm gelingt es, mehr Tore in einem Länderspiel zu schießen. Im offiziellen Bericht des Olympischen Komitees heißt es: „Russland war nicht in der Lage, ernsthaft Widerstand zu leisten, da die schnellen, schlagfertigen deutschen Stürmer die russische Abwehr [leicht] durchdrangen.“ Und der legendäre Bundestrainer Sepp Herberger schwärmt noch Jahrzehnte später, Gottfried Fuchs sei der Franz Beckenbauer seiner Jugend gewesen. Zwei Jahre zuvor hatte er seinen größten nationalen Erfolg gefeiert. An der Seite von Julius Hirsch gewann er 1910 mit dem Karlsruher FV die Deutsche Fußballmeisterschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg beendet Fuchs seine Laufbahn, widmet sich wie der Vater und Großvater ganz dem Holzhandel, heiratet und zieht schließlich 1928 mit seiner Familie nach Berlin. Dort währt das Glück nicht lange. Die Familie flieht 1937 vor den Nazis über die Schweiz nach Frankreich, von dort aus gelingt ihr 1940 in letzter Minute die Ausreise nach Kanada. Nach dem Krieg kehrt Godfrey E. Fochs – wie er sich nun nennt – zwar noch einige Male in die alte Heimat zurück, jedoch stets mit sehr gemischten Gefühlen. Im Alter von 82 Jahren stirbt er im kanadischen Montreal.
 Julius Hirsch (1892-1943)
Julius Hirsch (1892-1943)
Am 10. April 1933 informiert der „Sportbericht“, dass die süddeutschen Spitzenvereine beschlossen haben, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Erschüttert und „bewegten Herzens“ tritt Julius Hirsch daraufhin noch am selben Tag aus seinem „lieben Karlsruher FV“ aus – nach über 30 Jahren. Wie bitter muss dieser Moment für ihn gewesen sein! Ist er doch schon als 10-Jähriger dem Verein beigetreten, erringt mit ihm 1910 die einzige Deutsche Meisterschaft des Karlsruher FV, wird zum Nationalspieler und nimmt 1912 an den Olympischen Spielen in Stockholm teil. In dieser Zeit gilt Hirsch als einer der besten Fußballer Deutschlands. Nach einem Intermezzo beim Spitzenteam SpVgg Fürth und dem vierjährigen Militärdienst im Ersten Weltkrieg spielt er in den 1920er Jahren wieder für den Karlsruher FV. Seine Sportartikelfirma muss infolge der Weltwirtschaftskrise im Februar 1933 Konkurs anmelden. Enttäuscht von Vaterland und Heimatverein wendet er sich dem jüdischen Turnklub 03 Karlsruhe zu. Er wird durch die nationalsozialistischen Repressionen gedemütigt und entrechtet, nur weil er Jude ist. Am 1. März 1943 wird Julius Hirsch nach Auschwitz deportiert. Sein Name wird auch aus der kollektiven Fußballerinnerung in Deutschland getilgt. Erst als 1998 eine Sporthalle im badischen Pfinztal-Berghausen seinen Namen erhielt und der Deutsche Fußball-Bund 2005 den Julius Hirsch Preis ins Leben rief, erinnert man sich allmählich wieder des großen Fußballers.
 Julius & Hermann Baruch (1892-1945, 1894-1942)
Julius & Hermann Baruch (1892-1945, 1894-1942)
Bad Kreuznach – ein kleines Städtchen im Südwesten Deutschlands. Seit sieben Jahren ist Frieden im Land. Sportler sind die neuen Helden, vor allem die Ringer. Tausende jubeln ihnen bei ihren Wettkämpfen im Concordia-Saal zu. In diesem Jahr 1925 gewinnen Julius und Hermann Baruch zum ersten Mal die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Bei ihrer Heimkehr werden sie und der Rest der Mannschaft mit einer Musikkapelle am Bahnhof abgeholt und auf den Schultern begeisterter Anhänger durch die Stadt getragen. Bereits ein Jahr zuvor sind die beiden Brüder Europameister geworden: Julius im Gewichtheben und Hermann als Ringer im griechisch-römischen Stil. Ihren Triumph als deutsche Mannschaftsmeister können sie 1928 noch einmal wiederholen. Doch ihre Erfolge können die weit über die Stadt hinaus bekannten Sportler nicht vor dem wachsenden Hass auf Juden schützen. Ab dem Frühjahr 1933 werden die ehemaligen Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und Sporthelden der 1920er Jahre in Bad Kreuznach ausgegrenzt, gedemütigt und terrorisiert. Julius findet kaum noch Kunden für seine Autovermietung, lediglich die Polsterwerkstatt von Hermann läuft noch ganz gut, weil sich jüdische Kunden, die auswandern wollen, bei ihm ihre Möbel herrichten lassen. Im Herbst 1938 flieht Hermann nach Belgien, sein Bruder Julius bleibt mit seiner nicht-jüdischen Frau in Bad Kreuznach. Doch beide Brüder werden schließlich in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald ermordet.
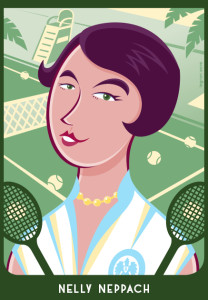 Nelly Neppach (1898-1933)
Nelly Neppach (1898-1933)
Mit 27 Jahren erreicht Nelly Neppach den Gipfel ihrer Tenniskarriere. Im Finale der Internationalen Deutschen Meisterschaften bezwingt sie 1925 die fünfmalige Turniersiegerin Ilse Friedleben. Sie gewinnt in dieser Saison acht von neun möglichen Meistertiteln und steht am Ende des Jahres gemeinsam mit ihrer Dauerrivalin Friedleben an der Spitze der nationalen Rangliste. In den Zeitungen wird Nelly Neppach zum Star. Doch dem reaktionären Deutschen Tennisbund missfällt das Auftreten der selbstbewussten Frau. Als sie es 1926 wagt, entgegen offizieller Verbandsvorgaben zu einem Turnier nach Frankreich zu fahren, erhält sie ein kurzfristiges Spielverbot. Denn das Nachbarland ist bei großen Teilen des konservativen Bürgertums verhasst. Öffentlich diffamiert der Deutsche Tennisbund ihren größten sportlichen Triumph als „Glückssieg“ und wirft ihr vor, „durch eigene oder befreundete Federn eine derartige Reklame in den Zeitungen getrieben [zu haben], dass der Deutsche Tennisbund in seinem Ansehen […] schwer geschädigt worden ist.“ Nelly Neppach entgegnet: „Niemals habe ich irgendwo einen wärmeren Empfang bekommen als von den Franzosen an der Riviera. Es sind meine eigenen Leute, die aus dem Hinterhalt auf mich schießen.“ Noch schlimmer kommt es im Frühjahr 1933. Da verbietet der Deutsche Tennisbund seinen jüdischen Mitgliedern, an den Spielen des Verbands teilzunehmen. Ihr Verein Tennis Borussia Berlin schließt sie aus. Nur wenig später nimmt sich Nelly Neppach das Leben.
 Lilli Henoch (1899-1942)
Lilli Henoch (1899-1942)
Starthocke, die Hände auf der Aschenbahn, ein konzentrierter Blick nach vorn. Es ist Lilli Henoch – eine entschlossene junge Frau – die das Sammelbild der Greilinger Zigarettenfabrik ziert. „Vielseitige Leichtathletin Deutschlands und Titelhalterin im Kugelstoßen und Diskuswerfen“ steht auf der Rückseite. Zur Königin der Leichtathletik wird sie bei den Deutschen Meisterschaften 1924 in Stettin. Sie gewinnt das Kugelstoßen, das Diskuswerfen und den Weitsprung. Nur knapp verpasst sie den Titel über 100 Meter, siegt aber mit der 4 x100 m-Staffel ihres Berliner-Sport-Clubs. Zwischen 1922 und 1928 wird sie insgesamt zehn Mal Deutsche Meisterin und erzielt vier Weltrekorde. Das macht sie zur erfolgreichsten Leichtathletin der 1920er Jahre. Daneben spielt sie erfolgreich Feldhandball und Hockey und engagiert sich in ihrem Verein – bis sie plötzlich 1933 als Jüdin ausgeschlossen wird. Lilli Henoch aber gibt nicht auf. Sie schließt sich dem Jüdischen Turn- und Sportklub 1905 an, betreibt weiter Leichtathletik und formt als Mittelläuferin eines der besten jüdischen Handballteams Deutschlands. Seit 1933 arbeitet sie an der jüdischen Volksschule als Turnlehrerin. Sie gilt als streng, ist aber sehr beliebt. Das Sammelbild ist unter ihren Schülern heiß begehrt. Trotz Angeboten als Trainerin im Ausland zu arbeiten, bleibt Lilli Henoch in Berlin, wo ihr Sportleben nach den Pogromen von 1938 beendet wird. Am 5. September 1942 wird sie zusammen mit ihrer Mutter nach Riga deportiert und ermordet.
 Erich Seelig (1909-1984)
Erich Seelig (1909-1984)
Innerhalb weniger Wochen im Frühjahr 1933 bricht in Deutschland für jüdische Sportler eine Welt zusammen. Offener Antisemitismus, marodierende SA-Schlägertrupps und gegen Juden gerichtete Vereinsausschlüsse sind an der Tagesordnung. Das zwingt auch den deutschen Box-Meister im Mittelgewicht und Halbschwergewicht Erich Seelig Ende März 1933, einen Kampf um seine Titelverteidigung abzusagen. Die Karriere des im westpreußischen Bromberg geborenen Seelig hatte zuvor vielversprechend begonnen. Als 14-Jähriger tritt er mit seinen beiden Brüdern der neu gegründeten Boxabteilung von Tennis Borussia Berlin bei. Nach ersten Erfolgen entschließt er sich 1931 zu einer Profikarriere – und erkämpft innerhalb von nur 15 Monaten die Titel des deutschen Meisters im Mittelgewicht und im Halbschwergewicht. Wenige Tage nach der erzwungenen Kampfabsage wird Seelig aus dem Verband Deutscher Faustkämpfer ausgeschlossen, seine Titel werden aberkannt. Er flüchtet über Paris, London und Kuba nach Amerika. Dort kämpft er weiter. Zunächst im Ring, bald aber auch politisch für einen US-amerikanischen Boykott der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Der Davidstern wird zu seinem Markenzeichen: Demonstrativ lässt er sich jenen gelben Stern auf seine Sporthosen drucken, den die Nationalsozialisten nutzen, um Juden zu stigmatisieren. Anerkennung in seiner früheren Heimat erfährt Erich Seelig nicht mehr. In einem Lexikon von 1956 findet sich indessen die bemerkenswert ignorante Feststellung: „Gab den Titel im März 1933 wegen Gewichtszunahme kampflos ab.“
 Rudi Ball (1910-1975)
Rudi Ball (1910-1975)
Hitler ist begeistert. Von der Tribüne des Eisstadions in Garmisch-Partenkirchen verfolgt der Diktator, wie die deutsche Eishockey-Auswahl in einem kampfbetonten Spiel Ungarn mit 2:1 niederringt. Held des Tages ist Kapitän Rudi Ball, der trotz einer blutenden Wunde bis zum Abpfiff auf dem Eis bleibt. Jener Rudi Ball ist mehrfacher deutscher Meister, Spengler-Cup-Gewinner und bekannt als „Maler auf dem Eis“. Von seinen jüdischen Wurzeln wissen die wenigsten Zuschauer bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Denn der deutschen Presse ist es untersagt, vom „Juden Ball“ zu schreiben. Rudi Ball wird auch dank des Beistands seiner Mitspieler, die auf seine Klasse nicht verzichten wollen, für Olympia nominiert. Denn für Hitler steht einiges auf dem Spiel, der sich von dem sportlichen Großereignis internationales Prestige erhofft. Ball kann für seinen Einsatz bei Olympia zudem die Auswanderung seiner gesamten Familie nach Südafrika erwirken. Sein sportliches Talent rettet sie vor dem Holocaust. Rudi Ball selbst bleibt auch in den Kriegsjahren in Deutschland, wo er für den Berliner SC spielt. „Ich bin jüdischen Glaubens, aber Deutscher unabhängig von meinem Glauben“, begründet er einmal seinen Antritt für das Nationalteam. Erst 1948 folgt er seiner Familie in die Emigration nach Südafrika, wo er seine Karriere bis 1951 fortsetzt.
 Helene Mayer (1910-1953)
Helene Mayer (1910-1953)
Mit gerade einmal vierzehn Jahren erkämpft sich die Schülerin Hleene Mayer die Deutsche Meisterschaft im Florettfechten. Es ist der Beginn einer grandiosen Sportkarriere. Fünfmal verteidigt sie mühelos diesen Titel. Bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam schlägt sie die besten Fechterinnen der Welt und holt Gold. Sie gewinnt zwei Europameisterschaften, wird erste Fechtweltmeisterin und triumphiert acht Mal bei den US-amerikanischen Titelkämpfen. Das ist die sportliche Seite ihrer Lebensgeschichte – die politische ist weit komplizierter. Bereits als junge Frau wird Helene Mayer mit ihren blonden Zöpfen und blauen Augen von der Presse als teutonisches Sportidol gefeiert. Der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hingegen vereinnahmt sie als Jüdin. Dabei fühlt sie sich als Deutsche, praktiziert den jüdischen Glauben ihres Vaters nicht. Später, da studiert sie bereits in den USA, wird sie zur zentralen Figur in der Debatte über einen US-amerikanischen Boykott der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Doch der Boykottaufruf scheitert – wohl auch, weil Mayer als „Alibjüdin“ der deutschen Mannschaft in Berlin teilnimmt. Dort unterliegt sie in einem knappen Gefecht ihrer Finalgegnerin und nimmt die Ehrung als Olympia-Zweite mit Hitlergruß entgegen. Sie verliert sich in den Widersprüchen von sportlichem Ehrgeiz, ihrer Vaterlandsliebe, ihrer Ächtung als Jüdin und politischer Vereinnahmung. Mit nur 42 Jahren erliegt sie im Herbst 1953 einem Krebsleiden.
 Martha Jacob (1911-1976)
Martha Jacob (1911-1976)
Auf stolze 38,24 Meter wirft die 18-jährige Martha Jacob ihren Speer. Es fehlen nur 15 Zentimeter zum Weltrekord! Damit gewinnt sie 1929 völlig überraschend die Deutsche Meisterschaft. Wenige Tage später wird sie in die deutsche Nationalmannschaft für den Frauenländerkampf gegen Großbritannien berufen. Mit ihren athletischen Leistungen und ihrer aufgeschlossenen Art begeistert die ausgebildete Diplomsportlehrerin Jacob auch die Gegnerinnen, die sie daraufhin bitten, die britischen Leichtathletinnen auf die Olympischen Spiele 1932 in Los Angeles vorzubereiten. Das Leben läuft gut für die sympathische junge Sportlerin, die seit Kindertagen im jüdischen Turnverein Bar Kochba Berlin Sport treibt und parallel für den professionelleren SC Charlottenburg Wettkämpfe bestreitet. Dann der Bruch. Im April 1933 flieht Martha Jacob aus dem inzwischen offen antisemitischen Deutschland. Ihre sportlichen Erfolge erringt sie nun auf internationalen jüdischen Sportveranstaltungen. Bei der Prager Makkabiade 1933 gewinnt sie Gold im Speer- und Diskuswerfen. Zwei Jahre später verpasst sie bei den World Maccabiah Games in Palästina den Sieg in ihren Paradedisziplinen nur knapp. Nach einer Odyssee durch Europa gelingt es Martha Jacob schließlich nach Südafrika zu emigrieren, wo sie prompt Landesmeisterin im Speerwurf wird. Sie findet dort ihr Glück, heiratet und bekommt zwei Töchter. Als sie 1952 ein letztes Mal für wenige Tage nach Berlin zurückkehrt, bricht sie überwältigt von schmerzhaften Erinnerungen zusammen.
 Gretel Bergmann (geb. 1914)
Gretel Bergmann (geb. 1914)
Margaret Bergmann-Lambert liebt ihr schmuckes Einfamilienhaus im New Yorker Stadtbezirk Queens und die Kirschbäume im Garten. Sie hat viel erreicht im Leben. Doch ein folgenschweres Ereignis vor fast 80 Jahren lässt sie nicht los. „Ich wurde um die Chance meines Lebens betrogen, nur weil ich als Jüdin geboren wurde.“ Rückblende: Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin soll Gretel Bergmann – wie sie damals noch heißt – für die deutsche Mannschaft im Hochsprung antreten, obwohl sie in ihrer Heimat als Jüdin längst geächtet wird. Man fürchtet, die USA würden die Spiele boykottieren und keine Olympiamannschaft entsenden, wenn Deutschland aussichtsreiche jüdische Sportler nicht nominiert. Doch nur einen Tag nachdem die US- amerikanischen Olympioniken den Hafen in New York nach Europa verlassen haben, teilt der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen Gretel Bergmann mit, dass sie aufgrund mangelnder Leistungen nicht an den Spielen teilnehmen darf. Es ist ein Schock für die junge ambitionierte Frau. Hatte sie doch erst wenige Wochen zuvor den deutschen Rekord eingestellt. „Ich war auf Augenhöhe, mit einer realistischen Chance, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen.“ Im Frühjahr 1937 wandert sie schließlich in die USA aus. Und noch im selben Jahr wird sie US-amerikanische Meisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. Heute, mit über 100 Jahren und silbergrauem Haar, blickt Margaret Lambert glücklich auf ihr Leben zurück – trotz der gestohlenen Olympiamedaille.
 Ralph Klein (1931-2008)
Ralph Klein (1931-2008)
Es ist kein Spiel wie jedes andere bei der Basketball-Europameisterschaft 1985, als Israel Gastgeber Deutschland mit 94:88 bezwingt. Denn mit Ralph Klein steht an der Seitenlinie als Trainer für Deutschland ein gebürtiger Berliner, Holocaust-Überlebender und israelischer Staatsbürger. Als „Vater des israelischen Basketballs“ erinnert man sich heute in Jerusalem und Tel Aviv an Klein. Sein größter sportlicher Erfolg als Vereinstrainer ist 1977 der Triumph im Europapokal mit Maccabi Tel Aviv – für den noch jungen Staat Israel ein bedeutender Meilenstein. Zwei Jahre später gewinnt Klein dann mit der israelischen Basketball-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei der EM in Italien – bis heute der größte Erfolg des Teams. Der Ruf als Trainer in die alte Heimat Deutschland kommt in Israel 1983 für viele überraschend, manche reagieren mit offener Ablehnung, als er nach einer Station beim BSC Saturn Köln deutscher Nationaltrainer wird. Doch Klein sieht die Dinge anders: Dass er in Deutschland gebraucht wird, ist für ihn auch ein persönlicher Sieg über die Nazis. Spiele gegen Israel will er dennoch zunächst nicht coachen, bis zu eben jenem Spiel 1985, von dem Zeitzeugen berichten, Klein habe hoffnungslos überfordert mit der Situation gewirkt. Doch trotz der Niederlage gegen Israel übersteht Deutschland die Vorrunde und erreicht am Ende den fünften Platz, die bis dato beste Platzierung. Nun ist Klein ein sportlicher Held in zwei Ländern, seiner alten und seiner neuen Heimat.
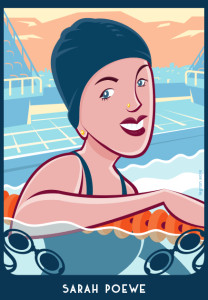 Sarah Poewe (geb. 1983)
Sarah Poewe (geb. 1983)
Athen im März 2000 – Kurzbahnweltmeisterschaften. Sarah Poewe schwimmt über 50 m und 100 m Brust zum Sieg. Es sind ihre ersten Goldmedaillen auf internationaler Bühne. Wenige Monate später nimmt die 17-Jährige aus Kapstadt an den Olympischen Spielen in Sydney teil – und verpasst nur knapp das Podest. In ihrer südafrikanischen Heimat aber fehlt der aufstrebenden Schwimmerin die Konkurrenz und die finanzielle Unterstützung. Daher entscheidet sie sich, künftig für das Heimatland ihres Vaters an den Start zu gehen und wechselt zum Deutschen Schwimm-Verband. Schnell gehört sie zur Spitze der deutschen Schwimmerinnen und gewinnt in den folgenden zehn Jahren 17 deutsche Meistertitel. Ihren größten internationalen Erfolg feiert sie bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, als sie mit der 4 x 100 m-Lagenstaffel dank neuem Europarekord die Bronzemedaille holt. Sarah Poewe ist damit die erste jüdische Athletin, die nach der Silbermedaille von Helene Mayer 1936 olympisches Edelmetall für Deutschland holt. „Das war mir eine große Ehre“, sagt Poewe, auch wenn ihre Religion Privatsache sei und mit ihren sportlichen Leistungen nichts zu tun habe. Zum Abschluss ihrer Karriere gelingt ihr noch einmal ein überraschender Erfolg: Sie erschwimmt bei den Europameisterschaften 2012 noch einmal Gold über 100 m Brust. Heute arbeitet die viermalige Olympionikin als Personal Swim Coach und ist Schwimmpatin der European Maccabi Games 2015 – an denen sie mangels Zeit nie als Aktive hat teilnehmen können.
Erschienen in: Felsberg, Stephan; Köhler, Tim (Hrsg.): Jewish Allstars. Deutsche Sportidole zwischen Erfolg und Verfolgung, Frankfurt (Oder) 2015.
